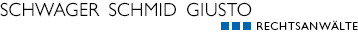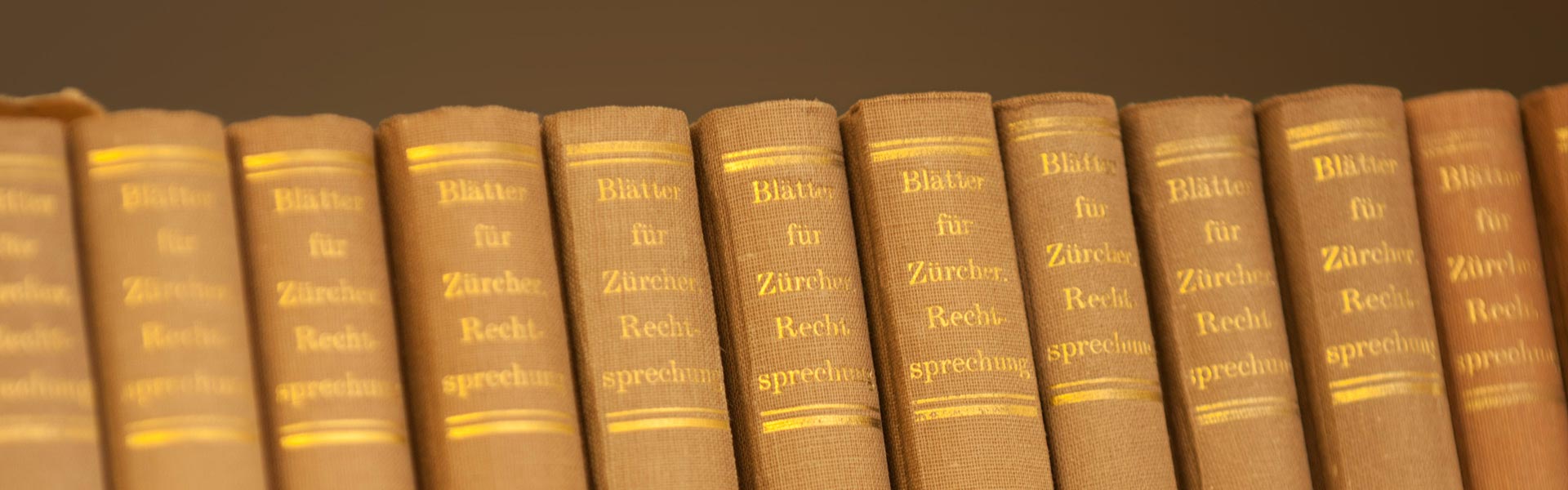Das Bundesgericht hat mit Urteil vom 2. Mai 2017 seine langjährige Praxis
geändert, wonach einem Unterhaltsschuldner, der auf böswillige Art sein
Einkommen vermindert mit der Absicht, seinem (früheren) Ehegatten reduzierte
Unterhaltsbeiträge bezahlen zu können, das zuletzt erzielte Einkommen
angerechnet wird, selbst wenn er den Verdienstausfall nicht rückgängig
machen kann. Das Verhalten des Unterhaltspflichtigen wurde als
rechtsmissbräuchlich eingestuft und die Abänderung respektive Reduktion der
Unterhaltsbeiträge verweigert.
Das Bundesgericht hat mit Urteil vom 21. September 2018 die Richtlinien, ab
wann und in welchem Umfang der hauptbetreuende Elternteil der Kinder die
berufliche Erwerbstätigkeit wieder aufnehmen muss, geändert.
Im Scheidungs- oder Trennungsfall kommt nach einer Übergangsphase oder bei
fehlender Vereinbarung der Eltern über die Art der Betreuung der Kinder das
sog. Schulstufenmodell zur Anwendung. Der hauptbetreuende Elternteil muss ab
der obligatorischen Einschulung des jüngsten Kindes zu 50 % eine
Erwerbsarbeit ausüben.
Ab Eintritt in die Sekundarschule ist die Erwerbstätigkeit auf ein 80 %
Pensum und ab dem vollendeten 16. Lebensjahr des jüngsten Kindes auf ein 100
% Pensum zu erhöhen. Davon kann im Einzelfall auszureichenden Gründen
abgesehen werden, beispielsweise bei einer Familie mit vier Kindern. In
einer ersten Phase wird in der Regel nach dem Grundsatz der Kontinuität und
Stabilität das vor der Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes gelebte
Betreuungsmodell fortgesetzt.
Das Verschweigen von ergangenen Strafurteilen oder anhängigen Strafverfahren
kann zur Nichtigerklärung der Einbürgerung führen. Dabei kommt es bei der
Beurteilung der Beachtung der Rechtsordnung aber nicht einzig auf die
bereits bekannten Strafuntersuchungen und -urteile an. Entscheidend ist das
tatsächliche Verhalten des Einbürgerungswilligen und nicht, ob allfällige
Strafdelikte schon vor der Einbürgerung entdeckt worden sind oder nicht.
Kann der Bewerber selbst keine berechtigten Zweifel an der Strafbarkeit
seines Verhaltens haben, täuscht er über eine Einbürgerungsvoraussetzung,
wenn er nicht auf mögliche Straffolgen hinweist.
Nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft besteht der Anspruch
des mit einem Schweizer oder einer Schweizerin verheirateten Ehegatten und
der minderjährigen Kinder auf Erteilung und Verlängerung der
Aufenthaltsbewilligung nur weiter, wenn die Ehegemeinschaft mindestens drei
Jahre bestanden hat und eine erfolgreiche Integration besteht oder wichtige
persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich
machen. In kürzlich veröffentlichen Entscheiden hat das Bundesgericht nun
klargestellt, dass für die dreijährige Dauer mehrere kürzere
Ehegemeinschaften mit verschiedenen Partnern nicht zusammengerechnet werden
dürfen.
Das Bundesgericht stellt es weiterhin in das Ermessen der Gemeinde, ob
Einbürgerungswillige im Rahmen der Prüfung der Integration auch Fragen zum
Allgemeinwissen zur Schweiz zu beantworten haben. Zum fairen Verfahren
gehört jedoch die Beachtung des Grundsatzes von Treu und Glauben, welcher in
diesem Zusammenhang fordert, dass solche Tests vorher angekündigt werden.
Die Bewerber müssen die Möglichkeit haben, sich wie bei einem schulischen
Examen mental darauf einzustellen, um die durch den Überraschungseffekt
bewirkten kurzfristigen Wissenslücken zu vermeiden. Wird lediglich zu einem
Behördengespräch eingeladen, muss nicht mit einer solchen Prüfung gerechnet
werden.